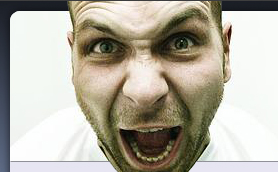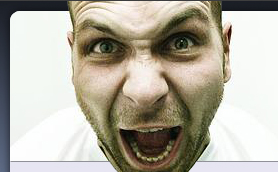Der Widerstand hat einen Namen: John Connor. Der Anführer der menschlichen Rebellion im zukünftigen Kampf gegen eine tödliche Herrschaft von Maschinen ist für die Menschheit in diesen grausamen Zeiten der einzige noch verbleibende Funke Hoffnung. Um der nahenden Niederlage zu entgehen, entsendet der einst im Guten von Menschenhand erschaffene Supercomputer
Skynet – mittlerweile mit eigenem Bewusstsein gesegnet und gar nicht mehr gut auf die Menschen zu sprechen – einen
Terminator in die Vergangenheit, um John Connors Geburt zu verhindern. Der Plan wird jedoch durch den Soldaten Kyle Reese, der von John Connor höchstselbst zum Schutze seiner Mutter zurückgeschickt wurde, vereitelt. Der Widerstand der Menschen scheint ungebrochen.
Auch der spätere Versuch, den mittlerweile 10-jährigen John durch eine Killermaschine aus der Zukunft zu beseitigen, ist nicht von Erfolg gekennzeichnet, der
Tag der Abrechnung, so wirkt es, für alle Zeiten abgewendet. Eine fatale Annahme, wie sich allerdings erst Jahre später herauskristallisieren soll, denn der Ausbruch des Krieges zwischen Mensch und Maschine – die
Rebellion der Maschinen – wurde lediglich aufgeschoben.
Und so befinden wir uns nun im Jahre 20
18 einer erschreckenden Zukunft, in einem Los Angeles, das nur noch entfernt an sein damaliges Erscheinungsbild erinnert. Inmitten des Brachlandes haust „Der Widerstand“, jene von John Connor (Christian Bale, „
The Dark Knight“ [2008]) angeführte Untergrundbewegung, die sich dem aussichtslosen Kampf gegen die übermächtigen Maschinen verschrieben hat. Zu allem Überfluss spitzt sich die sowieso schon bedrohliche Lage noch dadurch zu, dass Kyle Reese (Anton Yelchin, „
Star Trek“ [2009]), auf dessen Suche sich John Connor befindet, entführt wird und somit die gesamte Existenz der Menschheit auf dem Spiel steht. Denn als Reese damals die von Connor initiierte Zeitreise zur Rettung Johns Mutter antrat, wurde der Soldat zum einen deren Schutzengel. Zum anderen ging aus einem kurzen Liebesspiel neun Monate später John Connor hervor. Sollte
Skynet nun also Reese töten, wäre der zukünftige Anführer des Widerstandes nie geboren worden. So begibt sich John Connor auf die gefahrvolle Suche nach seinem Vater in spe, direkt hinein ins Herz der Dunkelheit.
Als bekannt wurde, dass
Joseph McGinty Nichol – kurz:
McG – einen vierten Teil der preisgekrönten Filmsaga um den Kampf der Menschen gegen die Maschinen drehen wird, waren die Lager schon gespalten. Der Produzent („
Supernatural“) und Regisseur solcher „Meisterwerke“ wie „3 Engel für Charlie“ (
„Charlie’s Angels“) [2000] und „3 Engel für Charlie – Volle Power“ (
„Charlie’s Angels: Full Throttle“) [2003] trat zweifellos ein schweres Erbe an, und nicht wenige sind heute der strikten Überzeugung, dass er es mal lieber ausgeschlagen hätte. Denn seine Vision eines postapokalyptischen, ausgebombten Amerikas unmittelbar nach dem Tag der Abrechnung ist trotz vieler Zitate, Querverweise und bekannter Namen alles andere als eine dem Titel (und der Reihe an sich) gerecht werdende Offenbarung, da die Geschichte des Aufstiegs John Connors zum Anführer des Widerstands mit der sich zeitgleich vollziehenden Stärkung
Skynets sich genauso schmalbrüstig gibt, wie bereits der kurze Storyabriss erahnen lässt.
Das wäre im Grunde nicht derart gravierend, würde sich der Film nur auf das konzentrieren, was die Vorgänger, insbesondere die ersten beiden Teile, so einzigartig machte. Trotz simpel wirkender Grundgeschichte, geboren aus den Hoffnungen und Ängsten der damaligen Zeit, beschrieben sie nämlich nicht mehr und nicht weniger als das Schicksal der Menschheit im Angesicht einer nahenden Katastrophe. All die Action, all die inszenierte Härte und Gewalt – sie war notwendiger Bestandteil dieses Kampfes der Menschheit, jedoch niemals das Hauptaugenmerk, auf das man sich als Zuschauer fokussierte. Es waren die
Schicksale der selbstlosen Einzelkämpfer Sarah Connor und ihres Sohnes John, die zum wahren Dreh- und Angelpunkt dieser einfachen, aber dennoch originell packenden Geschichte um Hoffnung in einer jeder Hoffnung entbehrenden Zeit wurden.
Davon merkt man in McG’s Werk trotz des apokalyptischen Settings leider überhaupt nichts mehr. Wie auch, lassen einen die Plattitüden schwingenden Rollen mit ihrem ansonsten fast nicht existenten Text doch einfach zu kalt, als dass man sich näher mit ihnen beschäftigen möchte. Hierzu bliebe im übrigen sowieso keine Zeit, da auch diese vierte Folge der T-Franchise jener verbreiteten Unsitte verfällt, welche meint, dass Spannung allein mittels einer Aneinanderreihung von Action-Sequenzen erzeugt werden könne. Dementsprechend kurz fällt dann auch die Präsens von Größen wie
Helena Bonham Carter („
Fight Club“ [1999]) oder
Michael Ironside („
Reeker“ [2005]) aus, deren Leistung im Nachhinein verpufft wie eine der unzähligen Explosionen, die im Laufe des Films gezündet werden.
Bryce Dallas Howard („
Spider-Man 3“ [2007]) als „Ersatz“ für Claire Danes, die im vorigen Teil die Rolle der Kate übernommen hat, ist gar völlig austauschbar, sieht man einmal gnädig von der Tatsache ab, dass sie mit ihrem jugendlichen Aussehen sowieso nur als glatte Fehlbesetzung zu bezeichnen ist.
Selbst Hauptdarsteller
Christian Bale wirft im Grunde nur mit bedeutungsschwangeren Sätzen um sich, wenn er mal nicht wieder heiser in ein Mikrofon flüstert oder grimmig in die hektisch umherwackelnde Kamera von
Shane Hurlbut blickt. Wahrscheinlich hat es der Gute in Wahrheit immer noch nicht so recht verkraftet, dass ihm Hurlbut während der Dreharbeiten „dreisterweise“ einmal ins Bild gelaufen ist. Als Quasi-Wiedergutmachung darf Bales Connor dann zumindest eines der weltberühmtesten Filmzitate in zweckentfremdeter Form zum Besten geben. Grimmig dreinschauend und heiser wie eh und je. Kamillentee soll ja wahre Wunder wirken, hört man.
Einzig die Rolle des plötzlich auftauchenden Marcus Wright (Sam Worthington), der sich auf die Suche nach sich selbst begibt, ist eines der wenigen Highlights dieses seelenlosen Actionfeuerwerks, das die einst als Geheimtipp gehandelte Reihe nun vollends der Massentauglichkeit unterworfen hat. Worthington bekleidet das Amt, Anfang und Ende des Films zu bestreiten. Natürlich kommen auch diese Szenen (vor allem der Schluss) nicht ohne aufopferungsvolle Gesten und den bedeutungsschwangeren Lichtblick am Horizont aus, aber das liegt nun einmal mehr im schwachen Drehbuch von
John Brancato und
Michael Ferris („
Catwoman“ [2004]) denn in Worthingtons Person begründet. Der charismatische Mime, den wir demnächst in James Camerons heiß erwartetem Langzeitprojekt „
Avatar“ [2009] sehen werden, tut definitiv sein Bestes, das ermüdende Kampfgetümmel mit so etwas wie Charakterzeichnung und Tiefgang anzureichern, indem die elementare Frage aufgeworfen wird, was den Menschen von der Maschine unterscheidet. Vollends gelingt dies dann aber doch nicht, denn der hektische Schnitt und der brachiale Sound überlagern den Großteil des Actioners, teilweise sogar den bombastischen Soundtrack von
Danny Elfman („
Hellboy 2“ [2008]).
Alles ist nur noch lauter, größer, gewaltiger. Doch anders als beim zweiten Teil, der Anfang der 90er Jahre mit diesem Credo noch zum Kassenschlager wurde, wirken die neu auftretenden Maschinen, allen voran der 24 Meter hohe
Harvester oder die
Moto-Terminatoren (ja, es gibt sie wirklich!), im vierten Teil nun merkwürdig fehl am ausgebombten Platze. Man wähnt sich zwischenzeitlich gar im falschen Film und wirft einen verstohlenen Blick in seinen Kalender, nur um sich zu vergewissern, dass heute noch nicht der 24.06.2009 ist, der Tag der Vorpremiere des neuen Michael Bay-Streifens „
Transformers - Die Rache“ [2009]. Ganz unschuldig sind die Verantwortlichen an diesem Eindruck nicht, da sich McG’s düstere Zukunftsvision laut eigenem Bekunden unter anderem als Hommage auf die „Mad Max“-Filme versteht. Und hier liegt dann wahrscheinlich auch der bellende Terminator begraben:
„TERMINATOR - DIE ERLÖSUNG“ ist vieles, ein düsteres Potpourri aus diversen Endzeitfilmen, dabei allerdings so wenig eigenständig wie ein Tisch, dem man fein säuberlich die Beine abgesägt hat, und mindestens ebenso flach.
So wird der Zuschauer trauriger Zeuge einer technisch perfekten Materialschlacht, die jedoch vollkommen austauschbar und zum Leidwesen aller auch noch
überflüssig ist. Wie soll man als Zuschauer mitfiebern, wenn eine Geschichte seit 1984 bekannt ist? –
Gar nicht. Welche neuen Aspekte sind einer Geschichte noch abzugewinnen, wenn im Grunde alles schon erzählt wurde? –
Keine, aus genanntem Grund. Daher dümpelt das lahme Skript auch über die gesamte Laufzeit immer irgendwo zwischen hektisch geschnittener Actionhatz und 08/15-Heldengeplänkel dahin, als wolle es dem von
Sam Worthington verkörperten Marcus Tribut zollen, welcher quasi erst gegen Ende erfährt, auf wessen Seite er wirklich steht. Nur ist das Drehbuch leider nicht zu solchen Entscheidungen fähig.
Würde John Connor plötzlich Neo heißen und anfangen, sich mit schwarzer Sonnenbrille der Übermacht der Maschinen zu erwehren: es würde schlichtweg nicht auffallen. Auch ein gutgemeinter (digitaler) Cameo von
Arnold Schwarzenegger kann nicht die Tatsache verleugnen, dass der Beginn dieser fiktiven Zukunft im Grunde nichts weiter ist als eine fast zweistündige Zurschaustellung der neusten Effekte – und der wohl teuerste Werbefilm der Welt für den nahenden zweiten Teil der „
Transformers“-Reihe. Mit der Saga, die Filmgeschichte schrieb, hat das vorliegende Actionspektakel hingegen bis auf einige wenige Lichtblicke nur noch den weltberühmten Namen im Titel gemein. Alles weitere sind haargenau dieselben Zutaten, die schon im Jahre 2003 bei „
Matrix Revolutions“ für Geschmacksverirrung gesorgt haben: Viel Gedöns und nichts dahinter. Scheinbar hatte da jemand noch Lust auf aufgewärmtes Reste-Essen.
Was Teil 5 kann, verraten wir euch in unserer „Terminator: Genisys“-Rezension [2015].