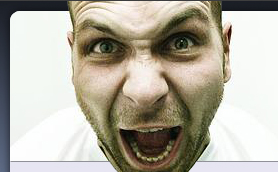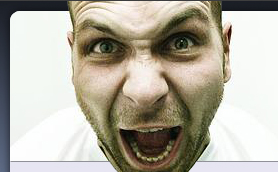von Asokan Nirmalarajah
Bei ihrer Europapremiere auf der diesjährigen Berlinale schlug der Wettbewerbsbeitrag
Side Effects (2013), die jüngste Genre-Fingerübung des amerikanischen Regisseurs Steven Soderbergh, unerwartet große Wellen. Gegenstand der Aufmerksamkeit war aber weniger der erotisch angehauchte Psychothriller als die Verkündung, dass es sich bei der starbesetzten Produktion um die letzte Kinoarbeit Soderberghs handeln würde. Während sich die Rezensenten damals noch in ihren überwiegend positiven Besprechungen des Films an einer Würdigung des Gesamtwerks des schwer zu klassifizierenden Auteurs versuchten, hat der Filmemacher inzwischen zurückgerudert und spricht nunmehr von einer kreativen Ruhepause. Das sei ihm auch vergönnt. Hat der unter anderem auch als Produzent, Kameramann, Editor, Skriptautor tätige Workaholic doch in den letzten 20 Jahren neben zahlreichen anderen Projekten wie Fernsehserien, Dokumentationen und Kurzfilmen über 20 Kinofilme inszeniert. Und trotz seiner großen Experimentierfreude zeigten die letzten, gewollt gegen den Strich gebürsteten Genre-Ausflüge des intellektuellen Stilisten bereits leichte Ermüdungserscheinungen. Die zunehmend kühle, distanzierte Erzählweise und glattgeleckte, sterile Optik findet sich auch in seinem mysteriösen Medizinhorror
Side Effects, der ohn
e jede Aufregung mechanisch seine Wendungen durchläuft.
Emily Taylor (Rooney Mara) könnte nicht glücklicher sein. Nach vier Jahren Haft wird ihr Mann Martin (Channing Tatum) endlich aus der Haft entlassen. Der frühere Investmentbanker saß aufgrund von Insider-Trading im Gefängnis und versucht nach seiner Freilassung sein Leben als erfolgreicher Geschäftsmann wieder aufzubauen. Seine schöne Frau aber begeht kurz nach seiner Rückkehr einen Selbstmordversuch. Schon seit Jahren befindet sich Emily aufgrund Depressionen in psychiatrischer Behandlung. Nach ihrem fehlgeschlagenen Suizid wird ihr der Psychiater Jonathan Banks (Jude Law) zugeteilt. Er verschreibt ihr das neue Anti-Depressivum Ablixa, angeregt von der Vergütung, die er von einem Pharmakonzern erhält für einen Testlauf mit seinen Patienten. Doch nach einer guten Testphase zeigen sich bei Emily seltsame Nebenwirkungen, wie eine Tendenz zum Schlafwandeln. Als sie unter dem starken Medikamenteneinfluss ohne ihr Wissen einen Mord begeht, gerät auch ihr behandelnder Arzt Banks ins Schussfeuer der Justiz…
Side Effects, dem in hiesigen Gefilden der unmissverständliche Untertitel „Tödliche Nebenwirkungen“ zur Seite gestellt wurde, klingt auf dem Papier wie ein Suspense-Film in klassischer Hitchcock-Manier. Und tatsächlich wirken nicht nur die doppelbödigen Hauptfiguren, die psychoanalytisch durchsetzten Dialoge und die irreführenden Elemente der Handlung einem Film des britischen Ausnahmeregisseurs Alfred Hitchcock entlehnt. Steven Soderbergh pfeffert seinen Thriller auch mit zahlreichen subtilen visuellen Anspielungen auf die charakteristische Mise-en-scène des Suspense-Meisters. Doch mit bloßem Zitatenkino begnügt sich das Drehbuch von Scott Z. Burns, der bereits mehrmals mit Soderbergh zusammengearbeitet hat, u.a. bei den ähnlich bieder-sozialkritischen, moralisierenden Dramen Der Informant! (2009) und Contagion (2011), nicht. Stattdessen wird hier zu einem Rundumschlag gegen die böse Pharmaindustrie ausgeholt. Burns, der sich eingehend mit den erschreckend steigenden Umsatzzahlen für Antidepressiva und Schmerzmittel in den USA befasst hat, lässt die Handlung als Krankheitsgeschichte beginnen, in der Medikamente keine Heilung, sondern Unheil bringen. Mit der Frau als psychisches Wrack, gezeichnet von den Dissonanzen der kapitalistischen Oberschicht, wähnt man sich schon fast im Terrain des Frauenfilms der 1940er Jahre.
Doch bevor man sich als Zuschauer in einem Genre einnisten kann, schaltet der Film in andere Genre-Modi. Leider schaltet er aber damit weder das Tempo hoch, noch mag er so mehr für das Schicksal seiner durchweg unsympathischen Figuren zu begeistern. Die fehlende Stilsicherheit bei diesen Sprüngen zwischen den Genres – vom Medizindrama hin zum Frauenfilm, vom Kriminalfilm hin zum Psychothriller, von der Gesellschaftssatire zum Suspense-Film – blockiert die Anteilnahme an den Figuren und ihrer Geschichte. Auch ergeben sich so logische Brüche und im Nachhinein lässt sich das Verhalten mancher Figuren an bedeutenden Punkten der Handlung nicht mehr nachvollziehen. Das ist dann hinsichtlich der Handlungsstruktur ärgerlich und unbefriedigend. Da kann die für Soderbergh-Verhältnisse gewohnt namhafte, solide Besetzung auch keinen Stich machen. Rooney Mara, die sich mit ihrer energetischen Vorstellung in David Finchers
Verblendung (2011) gar eine Oscar-Nominierung sicherte, mag weder als Opfer, noch als Täter in dem Verwirrspiel überzeugen. Zu reserviert, zu gelangweilt wirkt sie über die Länge des Films. Lobenswerter ist da ein nervöser Jude Law als moralisch ambivalenter Spielball der Intrigen und eine herrlich kaltherzige Catherine Zeta-Jones als zynische Strippenzieherin, die zum Ende hin aber leider in ein altbackenes Gender-Klischee stolpert.
Wie nicht selten bei Steven Soderbergh liest sich die Entstehung von
Side Effects spannender als das Endresultat. Wie schon bei seinem Callgirl-Drama
The Girlfriend Experience (2009), in dem er die damalige Pornoindustrie-Größe Sasha Grey besetzte, oder bei dem Actioner
Haywire (2011), in dem er den Mixed-Martial-Arts-Star Gina Carano als zukünftige Actionamazone etablierte, wollte der eigenwillige Regisseur auch diesmal eine besondere Frau in der Hauptrolle der psychisch labilen Emily besetzen. Die bereits für ihren Drogenmissbrauch und zahlreiche Klinikaufenthalten bekannte Lindsay Lohan war ernsthaft im Gespräch für diese Rolle und hätte sicherlich noch wie ihre Vorläuferinnen im Soderbergh-Kanon eine gehörige Portion Authentizität mit sich gebracht. Doch aufgrund ihrer legalen Probleme entschieden sich die Produzenten dagegen. Soderbergh, der, wie diese Beispiele und auch wie sein letzter kommerzieller und kreativer Erfolg, der dialogfreudige, lässige Stripperstreifen Magic Mike (2012) zeigen, an Performern aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten interessiert ist, die ihren Körper als temporäre Ware feilbieten, mag ohne Lohan hier nicht sonderlich viel aus dem Material herauskitzeln. So bleibt ein etwas mauer, halbgarer Adrian-Lyne-Abklatsch für die 2010er Jahre zurück, den man so schon oft besser gesehen hat.