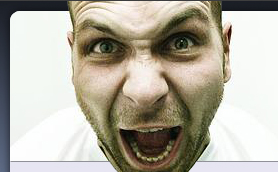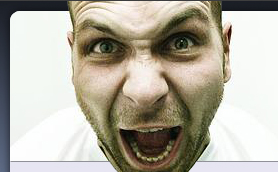Auch wenn es natürlich nicht gänzlich der Wahrheit entspricht, setzt man
Coming of Age inzwischen viel zu gerne in einen Kontext mit dem jährlich in Utah stattfindenden Sundance Film Festival, als würde Robert Redford („
Eine ganz normale Familie“) nicht seit dem Jahre 1981 dafür sorgen, dass sich die Festivität durch cineastische Vielfalt auszeichnet. Nichtsdestotrotz: Wenn wir vom Sundance Film Festival schwadronieren, dann machen sich sonnengeflutetete Alltagsimpressionen im Kopf breit; Heranwachsende, die sich durch ein pastellfarbenes (Wohlfühl-)Setting treiben lassen, um dem Zuschauer möglichst gemütlich aufzuzeigen, wie man mit sich und der Welt klarkommt. Und auch wenn sich diese Ansichten ganz eindeutig aus einer vorurteilsbehafteten Quelle speisen, so ist es doch nicht von der Hand zu weisen, dass Filme der Marke „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“, „Margos Spuren“ oder „Dope“ ihren erzählerischen Anker in einer Komfortzone werfen, in der sie nicht Gefahr laufen, zu tief in ihre Charaktere zu blicken; zu exakt auf Grauzonen aufmerksam zu machen.
Als Vergleich bietet sich da „Breakfast Club – Der Frühstücksclub“ von ganz allein an. Einfach aus dem Grund, weil er längst schon zum Paradebeispiel des
Coming-of-Age-Genres avanciert ist und quasi maßgeblicher Bestandteil des Grundwissens eines jeden Filmfreundes bedeutet. John Hughe
s, der 1984 mit „Sixteen Candles – Das darf man nur als Erwachsener“ bereits unter Beweis gestellt, dass ihm sein eigenes Erwachsensein noch nicht die Sicht auf die so fragile Welt der Jugendlichen beschlagen hat, macht sich mit „Breakfast Club – Der Frühstücksclub“ ganz grundsätzlich dadurch unsterblich, dass er seinen Hauptakteuren zuhört. Das mag sich nun banal vernehmen lassen, ist aber, wie so oft, der Schlüssel zum Erfolg. Dabei stehen die Zeichen auch hier zu Anfang auf Konvention: Eine x-beliebige Highschool und eine fünfköpfige Gruppe an Adoleszenten, die aus dem Off einer konkreten Typologie zugeschrieben werden: Von der Prinzessin über den Sportler bis hin zur Außenseiterin werden die Charaktere über eine klischierte Begrifflichkeit voneinander abgegrenzt.
Und das forciert den Effekt, dass auch wir, als Zuschauer vor der Leinwand, die Charaktere einzig über ihre Stereotype zu sehen versuchen. Wenn sich der von Judd Nelson verkörperte John Blender als extrovertierter Rowdy aufführt, dann ist das nur die Bestätigung der vorausgegangenen Einführung, die John als „Kriminellen“ festhielt. „Breakfast Club – Der Frühstücksclub“ aber distanziert sich im Verlauf seiner Handlung vom tumben Schubladendenken (das hat er, rein exemplarisch, auch dem zuletzt erschienenen „DUFF – Hast Du keine, bist Du eine“ meilenweit voraus) und berichtet von Emanzipation und Individualität. Die Jugendlichen sind zusammengekommen, weil sie nachsitzen müssen – und das auch noch an einem Samstag! Die Stimmung ist erhitzt, auch aus dem Grund, weil sich die drei Jungen und zwei Mädchen noch nicht im Klaren darüber sind, dass sie ihre stereotypisierten Hüllen tatsächlich ablegen können. Der Sportler (Emilio Estevez) muss auf seine Muskelkraft verweisen, genau wie die Prinzessin (Molly Ringwald) kategorisch die Nase zu rümpfen hat.
„Breakfast Club – Der Frühstücksclub“ aber dokumentiert einen Prozess der schleichenden Selbstwahrnehmung; er lässt die Jugendlichen, so wie es ihnen der Rektor aufgebrummt hat, einen Aufsatz über ihre Identität anfertigen, der sich durch den Dialog miteinander wie von selber von der Seele schreiben lässt. John Hughes adoleszenter Seelenstriptease ist so intim, wie Tränen in einer Gruppe von (eigentlich) Fremden nun mal sind; er ist so zärtlich und gleichzeitig ungebunden, wie Schmetterlinge, wenn sie merken, dass sie nicht für ein Leben auf dem Boden geschaffen sind und ihre Flügel zum ersten Mal spannen. Tatsächlich hätten die Offenbarungen aus dem zerklüfteten Innenleben, die alle Jugendlichen in dieser beinahe selbsttherapeutischen Anordnung ablegen, schnell ins Lächerliche abdriften können, aber John Hughes hört ihnen zu. Er lässt ihnen Zeit, zu wachsen. Er gibt ihnen Raum, sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen und zu hoffen, nie wie die eigenen Eltern zu werden. Das Herz darf nicht sterben. Vielleicht aber gehört das einfach dazu.
Cover & Szenenbilder: ©1985 Universal Pictures