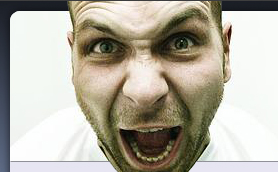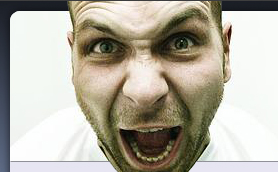Im Kern schildert „Pakt der Wölfe“, der zweite Spielfilm von „Crying Freeman“-Regisseur Christophe Gans, den Konflikt zwischen moderner, wissenschaftlicher Aufklärung und blinden Dogmen.
Die rund 200 Millionen französische Franc schwere Produktion ist dabei mehr als ein trockenes Stück Epochenkunde und integriert in ihre Geschichte, welche übrigens tatsächlich auf wahren Ereignissen basiert, Elemente aus so unterschiedlichen Genres wie dem Monsterhorror, asiatischen Martial Arts-Filmen und europäischem Kostüm-Kino.
Ähnlich wie Sir Arthur Conan Doyle in seinem Roman „Der Hund von Baskerville“, schickt Gans zwei Ermittler in das Gévaudan des 18. Jahrhunderts, um das Geheimnis einer blutrünstigen Bestie, welche die dortigen Einwohner dezimiert, zu lüften.
Der Naturforscher und „Freigeist“ Grégoire de Fronsac (Samuel Le Bihan) und sein indianischer Blutsbruder Mani (Mark Dacascos) stellen hier das Gegenstück zu Doyles berühmten Helden Sherlock Holmes und Dr. Watson dar.
Erzählt wird die Geschichte durch die Memoiren des Aristokraten Thomas d'Apcher, welcher die Geschehnisse einst am eigenen Leib miterlebt hat und nun, als alter Mann, den Unruhen der französischen Revolution ins Angesicht schauen muss.
Viel Zeit bleibt ihm nicht, für den persönlichen Blick in die Vergangenheit.
Während dunkle Wolken langsam sein Lebenslicht zu ersticken drohen, erinnert sich d'Apcher zurück an jene Tage, an denen eine schwache Kerze der Vernunft die Dunkelheit aus Angst und Lügen zu verdrängen vermochte...
Im Auftrag des Königs durchqueren Fronsac und Mani das Gévaudan und finden dort eine Mischung aus rauer Schönheit und engstirnigen Vorurteilen vor.
Sie sollen den vermeintlichen Killerwolf finden, töten und präpariert nach Paris schaffen.
Am Hofe der Familie Morangias befragen die Beiden zunächst die Überlebenden des Ungeheuers und machen sich außerdem mit den dortigen Persönlichkeiten vertraut.
Argwohn und Misstrauen schlägt ihnen von allen Seiten entgegen. Vor allem der Indianer wird kritisch beäugt.
Von der ersten Sekunde an verliebt sich Fronsac in die attraktive Morangias-Tochter Marianne (Émilie Dequenne), deren Bruder Jean-François (Vincent Cassel) das Auftreten der Gäste schon fast als Belustigung erachtet.
Die zuerst entspannten Nachforschungen spitzen sich schließlich unangenehm zu, als selbst nach einer ausgedehnten Wolfsjagd das Morden weitergeht und in einer Leiche ein Stück Metall gefunden wird.
Wölfe haben keine Fangzähne aus Metall.
Fronsac bohrt sich deshalb, zusammen mit Mani und dem faszinierten Thomas d'Apcher (Jérémie Renier), tiefer in das Treiben am Gévaudan vor und stößt auf ein dunkles Geheimnis, für das dessen Hüter töten...
Christophe Gans ist ein intelligenter und selbstbewuster Erzähler, und sein „Pakt der Wölfe“ eine inspirierte Explosion bunter Ideen.
„Ich wollte einen Film machen, den ich mir selbst im Kino anschauen würde,“ gibt der Bilderstürmer in einem Interview zu Protokoll und deutet darauf hin, dass sein persönlicher Geschmack, und nicht etwa steife Genregrenzen, die Marschrichtung der Arbeit dominiert haben.
Im Gegensatz zu vielen anderen französischen Werken seiner Zeit, wagt „Pakt der Wölfe“ mit seinem beachtlichen Budget einen mutigen Schritt aus dem Dunstkreis typischer Autorenfilme und schämt sich nicht, seine historische Thematik mit dem Spektakel des amerikanischen Popcorn-Kinos zu kreuzen.
Alles ist erlaubt, solange das Werk nicht auf der Stelle tritt und seine Zuschauer in die Lethargie zwingt.
Es gibt ruhige Szenen, in denen sich die Protagonisten beim Mahl zusammenfinden und über ihre unterschiedlichen Ansichten diskutieren, während in anderen Momenten Figuren, ähnlich wie Kung Fu-Kämpfer, gegeneinander antreten oder andere – wie in den alten
Hammer-Produktionen – im dichten Nebel von etwas Unbekanntem verfolgt werden.
Es gibt eine unschuldige Romanze, schwarze Magie, indianische Bräuche, ominöse Geheimbünde, einen unverhofften Schutzengel und blutige Morde.
Dass es sich bei dem vierbeinigen Unhold nicht bloß um eine grässliche Laune der Natur handelt, wird schnell klar.
Fronsac glaubt nicht an die fantastischen Geschichten der eingeschüchterten Menschen, und wir ebensowenig.
Die Theorie, dass die Bestie durch menschliche Grausamkeit für einen bestimmten Zweck manipuliert worden ist, bringt uns im Verlauf weiter, als die stumme Akzeptanz vom Hokuspokus.
Der Protagonist kämpft mit seinem Verstand beharrlich gegen den festgefahrenen Irrglauben an und stößt dabei vermehrt auf Widerstand.
Bis schließlich selbst der König dessen Bemühungen untergräbt, um schnell eine einfache Lösung des Problems zu liefern – auch wenn diese eben nicht die Wahrheit widerspiegelt und schlicht der Beruhigung des Pöbels dient.
„Pakt der Wölfe“ ist ein Werk, das auf verschiedenen Ebenen funktioniert - als simples Fantasyabenteuer, wie auch als ambitionierte, märchenhafte Aufarbeitung einer Epoche.
Perfekt ist es nicht.
Es sitzt prominent zwischen den Stühlen, zwischen Arthouse und all dem, was „anspruchsvolle“ Kinofreunde zutiefst verabscheuen. Das macht die Sache natürlich irgendwo kompliziert, aber keineswegs uninteressant.
Vielleicht braucht man, erst erschlagen von der hemmungslosen Stilvielfalt, sogar einen zweiten Anlauf, bis einen die Magie des cleveren Films wirklich erreicht.
Was aber zumindest jeder Zuschauer gleich mitnehmen kann, sind die opulenten Aufnahmen des dänischen Kameramanns Dan Laustsen („
Mimic - Angriff der Killerinsekten“), die die satten Farben der Kostüme und Ausstattung fabelhaft einfangen und den „Pakt der Wölfe“ selbst für latente Nörgler zum absoluten Augenschmaus werden lassen.
Auch Monsterfans kommen später voll auf ihre Kosten, wenn
Jim Hensons Creature Shop beweist, dass er nicht bloß schelmische
Muppets produzieren kann.
Ein dezentes Augenzwinkern findet man in der Inszenierung vor.
Beispielsweise, wenn sich während einer Überblendung der blanke Körper Monica Belluccis per Computertrick in eine verschneite Berglandschaft verwandelt.
So etwas sieht man in trockenen „Kunstfilmen“ eher nicht, denn da würden die betreffenden Zuschauer gleich empört ihre Nasen rümpfen.
Der Regisseur sieht das gelassen. Ihm gefällt das halt, auch wenn hinter der besagten Montage wohl kein tieferer Sinn steckt.
Über sich selbst reflektiert Gans dann übrigens grinsend, dass er vielleicht kein Mario Bava, sondern womöglich eher ein Antonio Margheriti sei.
Also vielleicht kein großer Meister, sondern einfach ein sympathischer Erzähler.
Und die braucht man schließlich auch, in der weiten Welt der Filmkunst.