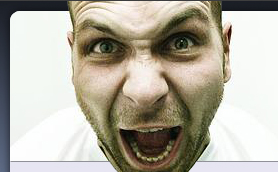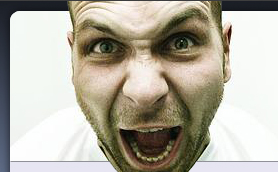(Deutschland, 2009)
Hans-Ulrich Jörges,
Stern-Journalist, der mittlerweile Treuepunkte für jeden Fernsehauftritt bekommen müsste, nutzte kurz nach der Bundestagswahl bei Frank Plaßberg noch einmal die Gunst der Stunde. Die besserwisserischen 68er-Lehrer waren wirklich schlimm, oder? Bernhard Bueb fällt einem da ein, bekannt für seine Lobpreisungen auf längst vergesse Werte wie Disziplin und Gehorsam und die Geißelung ihrer Verluderung durch die linke Hippiegeneration. Wie historisch kurzsichtig Gelüste nach der guten, alten Zeit sein können, zeigt uns Michael Hanekes neuer Film.
Das weiße Band spielt im protestantischen Dorf Eichwald in den Jahren 1913 und 1914. Komplett in Schwarz-Weiß gedreht. Ein Geschichtsbuch, das zu leben beginnt. Man fühlt sich an den Sozialkundeunterricht erinnert, wo man lernte, wie hart das Leben als Kind sein konnte, damals. Wie streng die Eltern und wie hart das tägliche Arbeiten auf dem Bauernhof war, wie weh die Peitsche auf dem Hinterteil tat. Der österreichische Regisseur zeigt uns eine Zeit, in der ein Fahrrad eine Kostbarkeit der Alltagslogistik darstellt. Wo Kinder „Ja, Herr Vater!“ sagen müssen. Wo es für Arbeiter nur arbeiten und „Maul halten“ gibt.
In diesem Dorf ereignen sich mysteriöse Unfälle. Der Dorfarzt fällt einem Anschlag zum Opfer und landet im Krankenhaus. Eine Müllerfrau kommt bei einem Arbeitsunfall ums Leben. Der klein
e Sohn des Gutsherren wird entführt und halb zu Tode gepeitscht. Doch keine Spur führt zu dem oder den Tätern. Nur einige Kinder im Dorf benehmen sich seltsam.
Haneke lässt ein breites Figurenensemble an uns vorbeiparadieren, alle mit einer eigenen Geschichte, hinter der meistens der Abgrund lauert. Der Dorfpfarrer, gespielt von Burghart Klaussner. Er redet wie gedruckt, predigt im Namen Gottes und prügelt seine Kinder nicht. Er „teilt zehn Rutenhiebe zu“. Es gibt des Gutsherren (Ulrich Tukur) und die Frau Baronin (Ursina Lardi). Den Bauern (Branko Samarovski) und seinen Sohn (Sebastian Hülk), der den Tod seiner Mutter rechen will. Den unerträglich zynischen Landarzt (Rainer Bock), der seine Geliebte, die Hebamme (Susanne Lothar) demütigt. Und den Dorflehrer (Christian Friedel), der mit dem Kindermädchen Eva (Leonie Benesch) anbandeln will.
Mit dieser Konstellation und einer leicht ins Unheimliche gleitenden Geschichte schafft Haneke mühelos einen, in wahrsten Sinne des Wortes, spannenden Film von zweieinhalb Stunden Länge, der die Sinne des Zuschauers unter ein Brennglas hält. Eine Art Twin Peaks auf den Hinterhöfen des Kaiserreichs.
Die Gewalt in ihren unterschiedlichsten Erscheinungsformen, sei sie physisch, sprachlich oder in Form sozialer Machtstellungen, ist ein beherrschendes Motiv dieses Films. Das letzte Mal widmete sich der 67-jährige Filmemacher dieser Thematik ausführlich in
Funny Games (1997), einem der psychologisch brutalsten Filme, den man in den Neunzigern auf einer Leinwand sehen konnte. Anliegen war ihm damals nichts weniger, als einen Gegenbeweis zum Geschäftsprinzip des modernen (Action-)Kinos anzutreten: dass Gewalt ästhetisierbar, gar ironisierbar sei, dass sie Bestandteil der Alltagsunterhaltung sein könne. Dem hielt Haneke die These entgegen, dass Gewalt nicht konsumierbar sei. Funny Games zeigt die leidenden Opfer, die in so vielen Genres marginalisiert werden. Dazu muss man nicht einmal mit dem Finger auf Horrorstreifen zeigen. Auch in James Bond-Filmen sterben Menschen wie die Fliegen. Der Österreicher will dem Zuschauer sagen: Guckt mal! Habt ihr euch mal gefragt, was ihr euch da die ganze Zeit anseht?
In seinem aktuellen Film wird dieses Thema auf sozialgeschichtliche Dimensionen expandiert. Denn hier werden die Opfer, zumindest deuten alle Zeichen darauf hin, zu Tätern. Die einen früher, die anderen später.
Die Erwachsenen leben ein Leben, in dem Triebe unterdrückt und Moral mit Füßen getreten werden. Die argumentative Schieflage, die dadurch entsteht, müssen sie nicht einmal rechtfertigen. Sie sind die Erwachsenen. Kinder bekommen die Gewalt, die durch diese Triebunterdrückung entsteht, ungefiltert ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie mit rhetorisch feingeschliffenen Moralpredigten verziert wird, wie es der Pfarrer bei seinen Kindern macht, oder ob der grobklotzige Verwalter (Josef Bierbichler) seinen Sohn ohne große Ankündigung zusammenprügelt. Kinder sind in diesem Film die stummen Opfer, die eigene Lehren aus dem Verhalten der Erwachsenen gezogen haben. Es ist die Generation, die zwanzig Jahre später Hitler, Weltkrieg und Holocaust möglich machen wird. Das weiße Band, das ein Symbol für Unschuld und Reinheit sein soll, gerinnt hier zum Sinnbild für kollektive Heuchelei.
Nun gibt es freilich kilometerlange Bücherregale voll mit belletristischer und geisteswissenschaftlicher Literatur darüber, wie Triebunterdrückung und Kadavergehorsam mit Kriegsgeilheit und der „Verliebtheit in den Führer“ zusammenhängen können. Sei es in Heinrich Manns Jahrhundertroman
Der Untertan, oder in den psychologischen Studien von Wilhelm Reich, Adorno, Fromm oder Alexander und Margarete Mitscherlich. Akademische Klarheit und Genauigkeit darf man von diesem Film nicht erwarten. Aber das wäre auch sehr unfair.
Als Kunstwerk, das Anschlüsse an Diskurse knüpfen kann, ist
Das weiße Band großartig. Nicht umsonst gewann Haneke zum ersten Mal bei den 62. Filmfestspielen in Cannes die goldene Palme. Er erzählt in stilvollen Bildern, von denen man nie weiß, ob man sie schön oder beklemmend finden soll. In der gespannten Stille, die von der ersten bis zur letzten Szene herrscht, werden selbst die banalsten Töne, wie das Herunterfallen einer Schüssel oder das Knarzen der Dielen, zu enervierenden Quasi-Schocks. Und selten konnte man in diesem Jahr ein Schauspielerensemble beobachten, das bis in die letzte Nebenrolle hinein wie angegossen passt.
Da verzeiht man auch gern, dass Haneke einen am Ende des Films mit leeren Händen dastehen lässt. Dass der 1. Weltkrieg die Geschichte einfach so abwürgt. Oder ist er, im Großen, nur die logische Konsequenz aus dem, was wir gerade im Kleinen gesehen haben? Mal im Ernst: dieser schroffe, unprätentiöse Schluss ist folgerichtig.
Denn eigentlich ist nichts feiger und unwahrhaftiger, als ein Happy End. Oder?