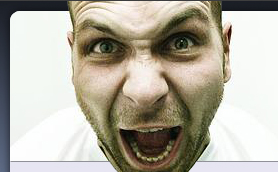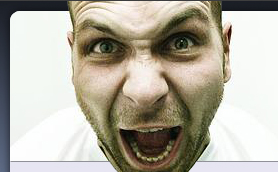von Asokan Nirmalarajah
Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist… kontrovers. Als
Caché (2005) auf den internationalen Filmfestspielen von Cannes erstmals gezeigt wurde, waren es nicht wie sonst bei den unangenehm perfiden Antifilmen des österreichischen Filmemachers Michael Haneke (
Benny’s Video, 1992,
Funny Games, 1997, und
Die Klavierspielerin, 2001, um nur seine wohl wirkmächtigsten Werke zu nennen) die schnörkellosen Gewaltszenen oder die verstörenden Charaktere, die zu der heftigen Diskussion unter Kritikern führten. Auch wenn es in Hanekes Film wieder vor höchst unsympathischen Menschen wimmelt, und der unvermittelte Schock einiger Gewalt- und Spannungsmomente einen noch lange verfolgt, war es eher seine Verweigerung einer zufrieden stellenden, erhellenden Aufklärung des zentralen Mysteriums der wie gewohnt unterkühlt und mit kluger medialer Selbstreflexion erzählten Geschichte. Diese endet nämlich mit einer der berühmten langen Einstellungen des Regisseurs, in der viel geschieht, aber man als Zuschauer nie genau weiß, wo unser Augenmerk liegen sollte. Während die einen meinten in diesen letzten Bildern zumindest die Andeutung einer potentiellen Erklärung auszumachen, erklärten andere die Szene zu eine der weiteren Irritationen des betont antagonistischen Films, der gar
nicht entschlüsselt werden, sondern nur die Schaulust des Zuschauer vorführen will.
Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist… mysteriös. Caché beginnt wie David Lynchs
Lost Highway (1997), allerdings ohne die ästhetische und musikalische Dichte des zu keiner Zeit realitätsnahen Noir-Alptraums, sondern eher mit einer klinischen Präzision und einem trügerischen Realitätsverständnis wie man es von Haneke mittlerweile gewohnt ist. Auch hier bekommt ein scheinbar harmonisches Ehepaar von einer unbekannten Person ein Videoband zugespielt, das statische Aufnahmen ihrer Haustür zeigt. Während bei Lynch eine verworrene Alptraumlogik herrscht, in der Identitäten sich auflösen, geht es bei Haneke um die verdrängte Vergangenheit des erfolgreichen TV-Moderatoren Georges Laurent (Daniel Auteuil), die ihn einholt und das Familienglück mit Ehefrau (Juliette Binoche) und Sohn (Lester Makedosnky) terrorisiert. Seine Recherchen nach der Herkunft der immer zahlreicheren und konkreteren Nachrichten in Form von weiteren Videos, Zeichnungen und Anrufen führen ihn nämlich nicht nur zurück zu einem tabuisierten Kapitel französischer Zeitgeschichte, sondern auch zu einer folgenreichen Tat in seiner Kindheit, die jemand zum Anlass nimmt, an ihm ein Exempel zu statuieren…
Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist… unangenehm. Während Georges Laurent, dessen Nachname natürlich eine Anspielung an die ominöse Figur des Dick Laurents aus
Lost Highway ist, mit der Vergangenheit der Nation und seiner eigenen hadert, werden er und der zu Recht gefesselte Zuschauer allerdings beständig irritiert durch einen Einbruch von Medialität, die erst nicht wahrnehmbar, dann wieder nicht erklärbar scheint. Denn nicht nur können die Laurents die Videokamera vor ihrer Haustür nicht finden, die ihren Alltag so exakt aufzeichnet, noch lassen sich wichtige Videoaufnahmen im weiteren Verlauf der Geschichte auf keine real existierende Kamera zurückführen. Was natürlich ganz im Sinne Hanekes ist, der schon in
Funny Games einen konventionell spannenden Plot über die Geiselnahme einer Durchschnittsfamilie durch psychotische Mörder störte, indem er den Voyeurismus des Zuschauers durch Brüche der filmischen Diegese böse kritisierte. Zwar spricht bei
Caché niemand direkt in die Kamera und bezieht damit den Zuschauer in seine abnormen Taten ein, noch wird die Filmrealität durch zeitliche oder räumliche Manipulationen ihrer Konstruiertheit überführt. Dafür aber weiß man hier nie wer wen beobachtet und warum, bis man sich seinem eigenen Voyeurismus und seiner passiven Mittäterschaft an den horrenden Vorgängen gewahr wird. Das ist alles sehr interessant und wird hier auch clever gezeigt. Nur macht das bei Haneke keinen Spaß.
Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist… witzlos. Während etwa Alfred Hitchcock in vielen seinen Filmen – z.B.
Das Fenster zum Hof (1954),
Vertigo (1958),
Psycho (1960) – amüsant mit dem Voyeurismus seines Publikums spielte, ohne dabei aber je seinen Spaß am Medium selbst zu verlieren, gebärt sich der humorlose Haneke wieder mal wie ein misantrophischer Schulmeister, der uns auch die Abgründe der menschlichen Psyche vorführen will, dabei aber großen Wert darauf legt, auch den abgebrühtesten Zuschauer mit einer inszenatorischen Skrupellosigkeit zu schockieren, die sich stets resolut jeder Mainstreamtauglichkeit entzieht. Als Kunstfilm-Auteur, der sich den narrativen und ästhetischen Konventionen des Hollywood-Films entgegenstellt (so ist in
Caché keine Musik zu hören), fordert Haneke uns zu einer gründlichen Hinterfragung diverser Realitäten auf, vergisst dabei aber zuweilen seine Zuschauer noch halbwegs zu unterhalten.
Siehst du auch, was ich (nicht) sehe? Wenn man aber davon ausgeht, daß Film bei Haneke nie Realitätsflucht, sondern stets mediale Autokritik darstellt, dann sollen seine Filme auch nicht unterhalten, sondern belehren und zur Diskussion anregen. Das tun sie natürlich nicht zu wenig, aber das eigentliche Problem besteht darin, daß man selten geneigt ist, sich auf seine
mindfuck-Filme einzulassen, wenn seine Figuren einem so gleichgültig sind wie bei
Caché. Trotz sehr guter Vorstellungen von Binoche und Auteuil ist man an der eigentlichen Handlung nur wenig interessiert, während die Verwirrung durch die verschiedenen medialen Ebenen des Films einen mehr fesselt, aber letztlich doch in ein provokant offenes Ende führen. So mag man
Caché, wie viele Arbeiten Hanekes, sicherlich für ihr perfektes Handwerk und ihre ausgeklügelte Konzeption schätzen, aber aufgrund der durchgehend abstoßenden Misantrophie und Kälte nicht wirklich mögen.