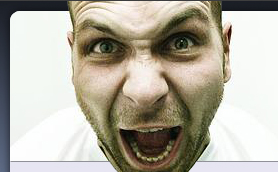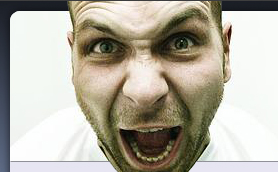Beinahe in Fötusstellung kauert Eve (Eva Green, „Sin City: A Dame to Kill For“) auf dem Bett ihrer Tochter Katrina (Shailene Woodley, „The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten“), apathisch, derangiert und wie vollkommen neben der Spur richtet sie sich auf und torkelt sie aus dem Zimmer, als Katrina sie darauf aufmerksam macht, dass der frühe Nachmittag schon längst angebrochen ist. Es ist eine der ersten Szenen des Films und gleichzeitig auch die erste konkrete Szene, die uns einen gewissen Aufschluss über die Beziehung von Mutter und Tochter gibt – Nur, dass wir an dieser Stelle noch nicht in der Lage sind, diesen Augenblick angebracht in das soziale Geflecht von „Wie ein weißer Vogel im Schneesturm“ einzuweben. Im neuen Film des „Mysterious Skin – Unter der Haut“-Regisseurs Gregg Araki thront die Mutter als überlebensgroßes, janusköpfiges Wesen über dem Szenario und hält den versierten Filmemacher vor allem dazu an, in der Vergangenheit das Gestern zu erforschen.
Natürlich spielt sich „Wie ein weißer Vogel im Schneesturm“ nicht im Hier und Jetzt ab, stattdessen geht es in die 1980er Jahre, wo sich die 17-jährige Katrina im adoleszenten Stadium einzig aus Fleisch, Blut und Hormone bestehen sieht: Und genau in dieser Zeit, wo sie sich nur als Körper (an-)erkannte, verschwand ihre Mutter spurlos vom Erdboden. Wer von Gregg Araki anhand dieser Ausgangslage erwartet, tief ins genretypische Kriminalgestrüpp abz
usteigen, der hat sich nicht wirklich mit dem Stil des Autorenfilmers auseinandergesetzt, wenngleich ein erkennbarer, aber niemals Überhand gewinnender Whodunit-Ansatz durch den Film mäandert: Greg Araki versucht sich immer mal wieder, Vermutungen im Kopf des Zuschauers sprießen zu lassen, konzentriert sich letztlich aber selbstverständlich darauf, die Coming-of-Age-Geschichte um Katrina auszubauen und anhand des Wusts an Gefühlen, der dem attraktive Mädchen fortlaufend zusetzt, zu grundieren: Als wäre man in der Pubertät nicht schon mit genügend persönlichen Zwistigkeiten beschäftigt, muss man zu allem Überfluss auch noch einsehen, dass die anderen Menschen auch ihr Kreuz mit sich herumschleppen.
Einen gewissen Narzissmus konnte man den von Gregg Araki ins Leben gerufenen Charaktere ja schon immer unterstellen, in „Wie ein weißer Vogel im Schneesturm“ mögen leichte Anflüge dessen ebenfalls erkennbar sein. Araki aber gelingt es ziemlich gut, seine Protagonisten immer als Menschen zu porträtieren, die dem Schwung und dem Rückstoß des Moments ausgeliefert sind, um diesen dann retrospektiv aufzunehmen, zu sezieren, zu verstehen. Katrina blickt immer wieder auf die Stunden mit ihrer Mutter Eve zurück; erinnert sich daran, dass sie sich im Beisammensein mit ihrer Mutter oftmals wie ein Haustier fühlen musste – Nicht umsonst wurde (Kat)rina auf diesen Namen getauft. Und immer wieder scheint es dabei so, als wäre Eve kaum noch wirklich anwesend, aber letzten Endes zu feige, um den Körper dem Geist folgen zu lassen, wenn sie für einige Wimpernschläge im Wellengang der weißen Laken verschwindet. Eve ist die omnipräsente Person in „Wie ein weißer Vogel im Schneesturm“, wenn sie tatsächlich im Bild ist, kehrt sie ihre gesamte Unzufriedenheit nach außen, in der Zeit ihres Verschwindens schwebt sie metaphysisch über den Köpfen.
Eve hatte viele Gesichter, vom aufreizenden Vamp zur verhärmten Ehefrau hin zum grellen Succubus, und sie gab ihrem bemühten Gatten Brock (Christopher Meloni, „12 Monkeys“) in jeder Sekunde zu verstehen, dass sie von ihm und ihrem gemeinsamen Leben als scheinbare All-American-Family angewidert ist: Die perfekte Familie ist gescheitert und trägt ein schwarzes Loch in ihrer Mitte, und in diese Leere wurde ein Kind geboren, welches zu früh lernen musste, sich hinter der Maske der Abgeklärtheit zu verstecken. Dementsprechend deutlich ist es auch zu verstehen, wenn „Wie ein weißer Vogel im Schneesturm“ von einem Teufelskreis spricht, in dem man sich zwangsläufig verlieren wird, wenn man seine Sehnsüchte tagein tagaus unterdrückt. Tatsächlich aber verfängt sich Gregg Araki ein Stück weit zu sehr im Nostalgischen, sucht immerzu den Blick zurück, anstatt den Charakteren einzugestehen, Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges in Erfahrung zu bringen. Obgleich man Arakis Faszination für verstrichene Epochen inzwischen kennt, scheint es partiell so, als würde er den Resonanzraum seiner Filme dadurch einengen.
Das satte Zeitkolorit, welches „Wie ein weißer Vogel im Schneesturm“ fortwährend auskostet, ist natürlich ein wunderbarer Blickfang, Arakis Auge für die damalige (Pop-)Kultur, den Synthpop, die Mode, den Dekor dürften bei manchen Zuschauern Wehmut evozieren, fungieren aber zum Glück nicht als bunt gechecktes Rüstzeug, um das große Schwärmen vor den Mattscheiben loszutreten. Nein, „Wie ein weißer Vogel im Schneesturm“ fertigt ein plastisches Bild jener Jahre an, ist indes aber mehr an den (auch wortwörtlich) auseinandergedrängten Figuren und ihrer Psychologie interessiert, als an der formalen Aufmachung, durch die diese schreiten dürfen. Tatsächlich ist „Wie ein weißer Vogel im Schneesturm“ der bisher konventionellste Film von Gregg Araki geworden, was ihn qualitativ nicht herabsetzen soll, aber ihn wohl am ehesten für die Publikumsschaft zugänglich macht, die sich mit dem Output des Independent-Auteurs, der ja eigentlich immer mindestens solides Material abliefert, und seiner durchaus bedeutsamen Position im New Queer Cinema noch nicht vertraut gemacht hat. Ein guter Film, zweifelsohne, aber dieses Mal kein herausragender.