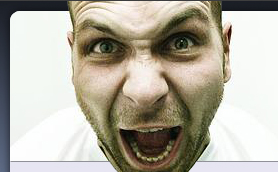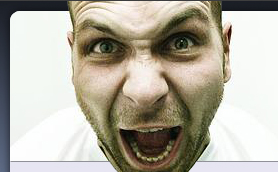Den Militäradministrationen dieser Welt wird seit jeher der Hang zur paranormalen Kriegsführung angedichtet: Das dritte Reich soll an UFO-artigen Flugkreiseln getüftelt und die Sowjetunion mit Psychokinese und Teslatechnik experimentiert haben. Die US-Armee kam neben diesen haarsträubenden Geschichten bisher relativ bodenständig daher – bis der britische Schriftsteller Jon Ronson 2005 endlich mit der Wahrheit herausrückte: Auch der rational apostrophierte Westen wollte seinen Teil vom Psi-Kuchen abhaben und suchte spätestens nach der Vietnamschlappe nach unkonventionellen Wegen, die Kriegsführung etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Hippie-Ideale, die seit den 70er Jahren zur gewaltlosen Kriegsführung genutzt werden, gehören ebenso zum kunterbunten Sammelsurium des Paranormalen wie der Schreck jeder gutbürgerlich rationalen Erziehung: Uri Geller. Dagegen mutet es wie selbstironische Kulturkritik an, wenn Kriegsgefangene im Irak stundenlang mit Kinderfilmmusik gefoltert werden. Und letzten Endes brachte man auch das Tierexperiment auf eine neue Stufe des Humanismus: Völlig schmerzlos wurden Ziegen via Telekinese über den Jordan geschickt – eine Technologie, für die jeder Metzger - Achtung: Wortwitz – töten würde. Kurz: Ronsons Buch ist ganz großer, nicht ernst zu nehmender, investigativer Journalismus und es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich auch das Kino des Stoffes annehmen würde. Herausgekommen ist eine herrlich skurrile Mischung aus Road
-Movie und Militär-Persiflage, deren Cast sich wie das Who is Who der hollywoodschen – man müsste fast sagen – Altherrenriege liest. Dass der Plot streckenweise in etwa so orientierungslos wirkt, wie die Ziege im Angesicht ihres Peinigers, schmälert den Gesamteindruck dabei nur minimal.
Was macht ein Mann in der Regel, wenn er von einer Frau verlassen wird? – Er zieht in den Krieg. Dieser Maxime fügt sich auch der junge Journalist Bob Wilton (Ewan McGregor), Reporter für die Lokalzeitung Ann Arbor. Kaum als Kriegsberichterstatter im fernen Kuwait angekommen, trifft er auf den designierten Soldaten Lyn Cassidy (George Clooney), der ihm eine haarsträubende Geschichte zu erzählen weiß: Er selbst sei Teil einer geheimen Hippie-Spezialeinheit der US-Armee, die sich in den 70er-Jahren unter Führung von Vietnam-Veteran und Oberguru Bill Django (Jeff Bridges) der gewaltlosen Kriegsführung verschrieben hat. Eine sagenhafte Story witternd, schließt sich Wilton dem desillusionierten Cassidy auf einem Road-Trip der ganz anderen Art an, der ihn nicht nur in 30 Jahre streng geheime Militärvergangenheit, sondern auch quer durch das besetzte Irak des neuen Jahrtausends und schließlich zu sich selbst führt…
Bereits zu Beginn hält Regisseur Grant Heslov dem geneigten Kinogänger unter die Nase, dass hinter seiner Geschichte mehr Wahrheit stecke, als man glauben würde. Sein Film benötigt eine derartige Verortung im investigativen Journalismus allerdings nicht. Vielmehr bieten Heslov und sein Drehbuchautor Peter Straughan dem Zuschauer über die nächsten knapp hundert Minuten komödiantische Fiktion vom Feinsten, die sich ebenso leichtfüßig ihrer literarischen Vorlage, als auch ihrer New-Age-Ikonografie nähert. Der Film stellt dem Zuschauer seine beiden Hauptprotagonisten als nostalgische Relikte vor, die vor der Kulisse des zweiten Golfkrieges keinerlei persönliche Orientierung mehr haben: Wilton ist ein Feigling, der sich seine Männlichkeit unter dem Mantel eines schrankenfreien Kriegsjournalismus zurückverdienen möchte; Cassidy folgt im wahrsten Sinne des Wortes einem gescheiterten Traum. Es gehört dabei zu den großen Stärken des Films, seine zwei Welten sich in Form einer roadmoviehaften Gegenwartserzählung annähern zu lassen. Der anarchische Zustand des Irak dient dabei als Katalysator für die beiden Figuren, deren Plausibilisierung sich episodenhaft vollzieht und die Heslov in Form von Rückblenden formalisiert: Dies funktioniert vor allem deshalb so souverän, da Heslov Wilton die Geschichte der New Earth Army zusammen mit den Zuschauern erschließen lässt.
So lernen wir dann auch nach und nach den Rest der namhaften Riege kennen: Jeff Bridges hat seinen ersten fulminanten Auftritt bereits in einer kurzen Vietnamrückblende, aus der er als geläuterter Hippie hervorgeht und alsbald einen ranghaften Namen in höheren Militärkreisen davon überzeugen kann, seine Vision einer Hippie-Spezialeinheit in die Tat umzusetzen. Und schon bald ist klar: Bridges hat wohl seit seinem süffisanten Auftritt als Dude und Althippie in The Big Lebowski nicht mehr soviel Spaß an einer Rolle gehabt: Der Charaktermime spielt sich souverän in die Herzen respektive Lachmuskeln der Zuschauer. Auch Kevin Spacey fühlt sich in seiner Rolle als intriganter, wenig talentierter, aber vom Ehrgeiz getriebener Psi-Rekrut sichtbar wohl. Clooney hingegen knüpft an seine pointiert ironische Rolle aus der Kriegs-Satire Three Kings an, während Ewan McGregor bereits im Drehbuch so geschickt platziert wurde, dass seine souveräne – aber nicht herausragende - Darstellung ihre Sympathie vor allem über eine gehörige Portion Selbstironie generiert: Wenn er Cassidy ganz naiv fragt, was denn bitteschön ein Jedi-Ritter sei, muss man ihn einfach auf der Stelle gern haben.
Überhaupt hat wohl in den letzten Jahren kaum eine Komödie eine derart hohe Schlagzahl an Pointen erreicht und wer beim Genuss der Trailer bereits Lachtränen in den Augen hatte, darf sich wie ein kleines Kind freuen: Die großartige Situationskomik funktioniert fast ohne Ausnahme über die gesamte Filmlänge, ohne dabei in plumpen Slapstick oder gar Fäkalhumor abzurutschen. Es ist dabei vor allem auch dem routinierten Ensemble zu verdanken, dass die eine oder andere Szene so brillant funktioniert, denn viel Witz generiert sich in actu aus dem akzentuierten Mienenspiel der großen Vier. Aber auch die Dialoge sind bis auf wenige Ausnahmen pointiert und temporeich. Auf beiden Ebenen zieht das Drehbuch vorrangig die Stereotypen der Flower Power-Bewegung durch den Kakao, was aber in letzter Konsequenz stets eine liebevolle Hommage an eine spaßige Episode jüngerer Kulturgeschichte bleibt. Mit dem komödiantisch institutionalisierten Randgruppenhumor jüngerer Hollywood-Komödien hat Heslovs charmante Nostalgie jedenfalls wenig zu tun.
Im Gegenteil hat
Männer, die auf Ziegen starren an mancher Stelle ein diametral gelagertes Problem: Der stetige Rückbezug auf einen irrsinnig modernen Krieg, der weder Freund noch Feind kennt und dem Film an vielen Stellen deutlich ernstere Untertöne verleiht, lässt die humanistische Hippie-Moral stellenweise wie einen belehrenden Zeigefinger am Horizont aufblitzen. Doch zum Glück bekommt Heslov die Kurve und beschließt seinen humoristischen Umgang mit dem Irakkonflikt augenzwinkernd genug, um ihn nicht als moralinsaures Plädoyer für ein Mehr an einender Wertvorstellung enden zu lassen. Und auch während des Films wird aufkeimenden Sentimentalitäten rechtzeitig durch präzise Situationskomik der Garaus gemacht. Passend dazu entlässt Heslov seine beiden Hippie-Helden in ein schwarzhumoriges Happy-End der ganz anderen Art und auch Tierschützer dürfen sich auf einen Lichtblick freuen. Dass der - durchaus stringente - Plot dabei eigentlich keinen Blumentopf gewinnen kann, ist zwar schade, passt aber zur anarchischen Grundstimmung eines Films, der letzten Endes weder episches Erzählkino, noch intelligente Kriegskritik sein möchte. Wer von derartigen Erwartungen also absehen kann, darf sich auf eine der bissigsten Komödien der letzten Jahre freuen. Alleine Jeff Bridges als Bill Django ist die Kinokarte wert.